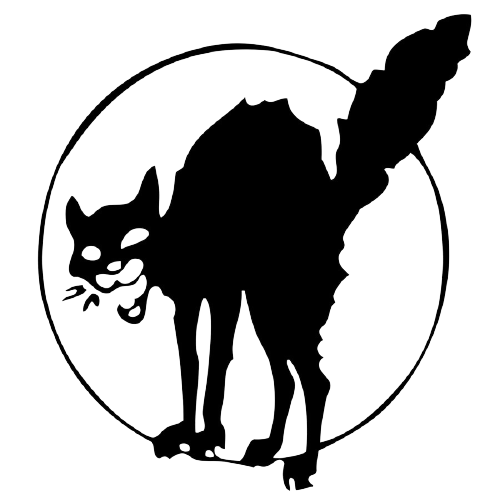Produktbeschreibung
Ein Arbeitskampf in einem kleinen Berliner Kino mit nicht einmal
drei dutzend Beschäftigten schlug 2009/2010 ungewöhnlich hohe
Wellen. In dem hochsubventionierten Vorzeige-Objekt der damals regierenden
Linkspartei hatten es erstmals einige prekäre Teilzeitkräfte
gewagt, die Frage nach einer adäquaten Interessenvertretung selbst
zu beantworten, und brachten die politische und gewerkschaftliche
Landschaft der Hauptstadt damit ordentlich in Wallung. Das Kino
Babylon wurde zum Politikum. Nicht nur der Berliner Senat, die
höheren Etagen der Linkspartei und der Gewerkschaft ver.di fühlten
sich genötigt, zu intervenieren, letztlich wurde die Frage, was überhaupt
eine Gewerkschaft ist, neu gestellt.
Der Konflikt zeigte, dass auch in Kleinbetrieben mit prekären Verhältnissen
offensive Kämpfe und gewerkschaftliche Alternativen
nicht nur nötig, sondern auch möglich sind, aber auch, mit welcher
Vehemenz genau dies verhindert werden sollte. Um so wichtiger, aus
dieser Erfahrung zu lernen.
Schafft zwei, drei, viele Babylons!
Buchbesprechung von Teodor Webin
Hansi Oostinga: BabyloHn. Der Arbeitskampf im Berliner Kino Babylon. Syndikat A, Moers 2015, 36 Seiten, 2,50 Euro, ISBN 978-3-9817138-9-3
Als die anarchosyndikalistische Freie ArbeiterInnen Union (FAU) Berlin 2009 mit ihrem Lohnkampf im Kino Babylon und dem ersten Versuch, einen Tarifvertrag abzuschließen, an die Öffentlichkeit ging, war das zwar im Vergleich zu den Arbeitskämpfen größerer Gewerkschaften nur ein kleiner Kampf, aber das Rauschen im linken Blätterwald war groß. Nicht zu Unrecht, denn für die Geschichte des Anarchosyndikalismus hat die FAU Berlin damals neue Maßstäbe gesetzt. Das konkrete Engagement im Babylon machte aus einer gewerkschaftlich orientierten Polit-Gruppe eine politische Gewerkschaft, und dieses eigentlich alte, seit den 1990ern aber kaum noch ge- und erlebte Konzept gewann in Berlin ungeahnte Attraktivität und die FAU Berlin ein vergleichsweise großes Wachstum, das bislang keine andere Basisgewerkschaft wieder erreicht hat – die erste Ausnahme ist seit 2014 die Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO).
Das Erfolgsrezept war einfach: Die FAU Berlin hat schlicht an vielen Stellen gezeigt, dass sie es ernst meint mit der kollektiven Aktion für die prekär Beschäftigten und der Solidarität. Sie legte sich nicht nur mit dem cholerischen Geschäftsführer Timothy Grossmann, sondern auch mit ver.di, der Linkspartei und dem Berliner Senat an.
Sie warf alte Ideologien wie die lange übliche prinzipielle Ablehnung von Tarifverträgen über Bord. Sie organisierte Medienaufmerksamkeit, internationale Solidarität – nicht nur unter den anderen syndikalistischen Gewerkschaften, sondern z.B. auch von den bengalischen Garment Workers – und setzte sich gemeinsam mit der bundesweiten Föderation FAU vor der ILO (International Labor Organisation) für ihre eigenen Gewerkschaftsrechte ein.
Das alles sollte für eine funktionierende Gewerkschaft Minimalanspruch und Alltag sein. Das war es aber für die FAU die dreißig Jahre davor nur in seltenen Fällen. Damit hat die FAU Berlin den modernen Syndikalismus im Niveau deutlich angehoben. Dieser Konflikt hat also eine Auszeichnung verdient, die er nun in Form einer Broschüre aus dem Hause Syndikat A erhalten hat.
Hansi Oostingas Text, der einen detaillierten Überblick über den Arbeitskampf liefert, ist zuvor schon in der Zeitschrift ‚emanzipation‘ erschienen, wurde aber für das Broschürenformat noch einmal überarbeitet und aktualisiert. Und hat außerdem Bilder. Oostinga definiert auf den Punkt, wo die Relevanz dieses vergleichsweise kleinen Arbeitskampfs liegt: Erstens wurde mit ihm öffentlichkeitswirksam „die Frage, was überhaupt eine Gewerkschaft ist, neu gestellt“ und zweitens „wagten es erstmals einige prekäre Teilzeitkräfte, die Frage nach einer adäquaten Interessenvertretung selbst zu beantworten“ (S.3).
In der Praxis zeigten sich beide Aspekte darin, dass der Konflikt in einer basisdemokratischen Form geführt wurde – und das meint keine Konsensorientierung, sondern die gemeinsame Formulierung von Forderungen, die gemeinsame Erarbeitung einer entsprechenden Kampagne und jederzeitige Rückkopplung mit den Arbeitenden (S.13/S.29).
Auch für die (Arbeits-)Rechtsgeschichte ist der „Fall Babylon“ ein relevantes Ereignis, obwohl die Macht der Verhältnisse diese Relevanz bis heute unterdrückt – in die klassischen Arbeitsrechtskommentare wurde er bislang – und ich würde behaupten: wider besseren Wissens – nicht aufgenommen. Hansi Oostinga beschreibt, wie das Berliner Landgericht (und eben kein Arbeitsgericht!) dezidiert argumentiert, dass das deutsche Recht eben keine kleinen, kämpferischen Gewerkschaften vorsieht! Ob das tatsächlich, wie Oostinga meint, ein „einmaliger Vorgang in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte“ (S.26) ist, sei dahingestellt, ein juristischer Skandal ist es allemal.
Ein kleiner Konflikt – und doch hat er vieles verändert
Die heutigen Kämpfe und Erfolge der kleinen syndikalistischen Bewegung, z.B. der Streik in der alternativen Dresdener Kneipe ‚Trotzdem‘, die vielbeachtete Kampagne um die Berliner „Mall of Shame“ und der meines Wissens erste syndikalistische Haustarifvertrag in der Geschichte der Bundesrepublik, wären ohne die Vorarbeit im Kino Babylon nicht möglich gewesen. Wenn schon sonst nichts erreicht wurde, so doch wenigstens ein Leuchtturm proletarischen Protests, ein Kick-Off des neuen Syndikalismus.
Aber es stimmt nicht, dass der Arbeitskampf seinerzeit nichts erreicht hätte: Der Tarifvertrag, der letztlich mit ver.di – die in dieser Geschichte die Rolle der gelben (d.h. unternehmerfreundlichen) Gewerkschaft spielt – ausgehandelt wurde, lag zwar unter dem Niveau des ver.di-Flächentarifvertrags für die Kinobranche, war aber dennoch erst mal eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, die es ohne das Engagement der FAU Berlin und vor allem der Kolleg*innen im Betrieb selber schlicht nicht gegeben hätte (S.29). Solche Kämpfe sind nie einfach und bringen gewisse „Verluste“ mit sich. Oostinga beschreibt die Situation im Babylon als „alltäglichen Guerilla-Krieg“ (S.28), der Geschäftsführer ist bis heute auf Klassenkampf von oben gebürstet – obwohl er sich (ähnlich wie die Kneipenbesitzerin des 2014 von der FAU bestreikten ‚Trotzdem‘ in Dresden) als „links“ gebärdet.
Auch ver.di hat mittlerweile eingesehen, dass der Tarifvertrag vom 1. Januar 2010 nicht das Gelbe vom Ei ist. 2014 gründete sich im Kino Babylon eine ver.di-Betriebsgruppe und zum 31.12.2014 wurde der bisherige Tarifvertrag gekündigt. Seit Mai 2015 findet sich die Belegschaft wieder im Arbeitskampf, den auch die FAU Berlin unterstützt. Der bisherige Höhepunkt dabei ist die im Oktober stattgefundene seltsame Aktion von Grossmann, sein Kino, angetan mit einer Streik- bzw. Warnweste, mit Davidssternen zu besprühen und in Fraktur selber zum Boykott aufzurufen. Kurz: Er stilisiert sich „künstlerisch“ als Opfer und vergleicht sich mit den Opfern des Nationalsozialismus – und implizit damit die Gewerkschaften mit den Nazis. Hätte ver.di 2009 ein offeneres Ohr gehabt, hätten sie ahnen können, mit was für einem cholerischen Charakter sie es zu tun bekommen.
Hansi Oostingas Fazit fällt in gewissem Sinne pessimistisch aus: „Für Beschäftigte dieser Branche sendet der Fall Babylon deshalb das Signal aus: die konventionellen Gewerkschaften wollen euch nicht und der Aufbau eigener gewerkschaftlicher Interessenvertretungen ist derzeit rechtlich kaum möglich. De facto ist das Grundrecht der Koalitionsfreiheit für diesen Sektor damit aufgehoben“ (S.30).
Sinnvoll wäre 2009 eine Tarifgemeinschaft aus FAU und ver.di gewesen, dies scheiterte aber an dem Desinteresse für die prekär Beschäftigten wie auch an einem Gewerkschaftsegoismus, der die Interessen der Arbeitenden hintenan stellt.
In der Prekarität sind wir zurückgeworfen auf die Zustände der Frühindustrialisierung und müssen uns unsere selbstorganisierten Interessenverbände mühsam gegen Staat und Kapital aufbauen. Babylon war erst der Anfang.
(aus der GWR Nr. 403, November 2015)
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2021 in unseren Katalog aufgenommen.